Aufwachsen mit Medien
TikTok, Snapchat, ChatGPT – digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Jugendlichen. Sie sind wichtig, um Freundschaften zu pflegen, mitreden zu können oder für die Schule zu lernen. Und immer wieder geht es um Fragen wie: Wer möchte ich sein? Wie will ich mich zeigen? Wer inspiriert mich? Auch rund um Sexualität, Flirten und Verliebtsein spielen digitale Medien eine zentrale Rolle.
Soziale Medien geben den Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen: Fotos und Videos posten, Beiträge von anderen liken und kommentieren, sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Das hilft bei der Selbstfindung, kann aber auch zu Druck führen: Erhalte ich Likes? Werde ich kritisiert oder gar beleidigt?
Jugendliche wollen möglichst viel selbst entscheiden. Trotzdem brauchen sie Erwachsene, die zuhören, kritisches Denken fördern und da sind, wenn es Probleme gibt.
Allgemeine Informationen
Gut zu wissen
Allgemeine Informationen
Gut zu wissen
Sprechen Sie darüber, dass mehr Selbstständigkeit auch mehr Verantwortung bedeutet, etwa bezüglich Abo-Kosten, aber auch bei Sicherheitsaspekten, sensiblen Themen oder mit Blick auf angemessenes Verhalten in der digitalen Welt.
Selbst wenn Ihre Kinder Sie überholen, wenn es um das technische Verständnis geht: Medienkompetenz beinhaltet einen kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit medialen Inhalten und technologischen Möglichkeiten. Um den Jugendlichen diese Aspekte vermitteln zu können, müssen Sie nicht unbedingt alle Apps und Online-Trends verstehen. Die Lebenserfahrung, die Sie als Erwachsene mitbringen, sowie das ehrliche Interesse am Online-Leben Ihres Kindes ist hier von grosser Bedeutung.
Grundsätzlich ist immer Vorsicht geboten bei persönlichen Angaben und Fotos von sich und anderen. Dinge, die einmal online sind, lassen sich zudem oft nicht mehr löschen. Oder sie werden weiterverbreitet, ohne dass man das selber kontrollieren kann. Ausserdem hat jeder Mensch das Recht am eigenen Bild. Vor dem Posten oder Verschicken von Fotos und Videos sollte die Zustimmung der abgebildeten Personen eingeholt werden.
Und Ihr Kind sollte wissen, dass Profile auch gefälscht sein können. Pädosexuelle nutzen häufig soziale Netzwerke und Chats, um Kontakt aufzunehmen.
Medien spielen für Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens eine wichtige Rolle. Wird der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit grösser, grenzen sie sich unter anderem durch ihre Mediennutzung von den Eltern ab. Sie suchen sich eigene (digitale) Räume.
Unterstützen Sie Ihr Kind in diesem (ganz normalen) Ablöseprozess, indem Sie ihm schrittweise mehr Freiheiten gewähren, gleichzeitig aber im Gespräch und interessiert bleiben.
Nicht alles, was professionell aufbereitet und seriös erscheint, ist auch tatsächlich wahr. Helfen Sie Ihren Kindern dabei, Strategien zu entwickeln, um Medieninhalte kritisch zu prüfen. Auch Marketingstrategien sollten Jugendliche verstehen, z. B. Produktplatzierungen auf den YouTube- und Social-Media-Kanälen ihrer Idole.
Gerade bei Influencer-Accounts und überhaupt im Werbebusiness geht es zudem um vermittelte Werte, Rollenbilder und Schönheitsideale. Diskutieren Sie darüber und machen Sie deutlich, dass die gezeigten Fotos und Videos meist bearbeitet sind.
Digitale Medien gehören zum sozialen Leben von Jugendlichen. Das hat viele positive Seiten, denn Jugendliche können sich so austauschen, kreativ ausdrücken, informieren und inspirieren lassen.
Es gibt aber auch negative Einflüsse, wenn Jugendliche zum Beispiel:
das Gefühl haben, immer online erreichbar sein zu müssen
Angst haben, etwas zu verpassen (Fear of missing out, FOMO)
abends zu lange am Handy sind und deshalb unter Schlafmangel leiden
sich mit dem scheinbar perfekten Leben und Aussehen von Internet-Berühmtheiten vergleichen
von anderen im Netz beleidigt oder gemobbt werden
sich zu sehr mit schlechten oder beunruhigenden Nachrichten beschäftigen
Das psychische Wohlbefinden hängt immer auch mit anderen Faktoren zusammen. Dazu gehören der Selbstwert oder das Gefühl, eingebunden zu sein und verstanden zu werden, aber auch das familiäre Umfeld. Zudem können soziale Netzwerke auch ein Ort sein, um sich über mentale Gesundheit auszutauschen, über psychische Krankheiten aufzuklären und diese zu entstigmatisieren.
Vereinbaren Sie gemeinsam wöchentliche Bildschirmkontingente bzw. konkrete Offline-Zeiten. Und bleiben Sie als Eltern mit Ihrem Kind im Gespräch – ohne kontrollieren zu wollen und ohne vorschnell zu bewerten. Fragen Sie zum Beispiel: «Wie geht es dir, wenn du das nutzt/siehst/liest?» oder «Was macht dir Spass, was stresst dich?» Solch offene Fragen helfen Jugendlichen, über ihr digitales Verhalten nachzudenken.
Zudem gibt es Funktionen oder Apps, mit denen Handy-Nutzungszeiten im Auge behalten oder eingeschränkt werden können. Push-Benachrichtigungen können ausgeschaltet wer-den. Auf Social Media sollte man nur Persönlichkeiten folgen, die ein gutes Gefühl vermitteln. Eigene Profile können auf privat gestellt oder so genutzt werden, dass keine Kommentare möglich sind.
Vor allem aber brauchen Jugendliche das Gefühl: Ich kann zu Hause, mit meinen Eltern über alles sprechen – auch über das, was mir online Angst macht oder mich traurig stimmt.
Psychische Gesundheit
Weiterführende Links
Anlaufstellen für Jugendliche
Jugendliche verbringen häufig mehrere Stunden pro Tag an ihrem Handy oder mit Videospielen – alleine die Nutzungszeit ist jedoch kein Beweis für eine Sucht. Von Onlinesucht spricht man erst, wenn eine übermässige Nutzung des Internets vorliegt, welche die Persönlichkeit und die Gesundheit einer Person schädigt. Eine problematische Nutzung kann jedoch vorliegen, ohne dass alle Kriterien für eine Sucht erfüllt sind. Anzeichen für eine problematische Internetnutzung bei Jugendlichen können sein:
Die Person verspürt einen starken Drang, immer online zu sein und kann sich nicht selbst einschränken, auch wenn das Verhalten negative Konsequenzen hat (Kontrollverlust).
Sie trifft sich kaum mehr mit Gleichaltrigen (oder nur noch online) und nimmt ungern am Familienleben teil.
An Freizeitaktivitäten, die früher wichtig waren, hat die betroffene Person kein Interesse mehr.
Sie wirkt oft übermüdet, ist nicht mehr leistungsfähig (in der Schule oder im Beruf) und zieht sich zurück.
Wenn Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen möchten, vermeiden Sie es, ihm Vorwürfe zu machen. Sagen Sie, dass Sie sich Sorgen machen und weshalb, fragen Sie nach, wie es Ihrem Kind geht und ob es sich wohl fühlt mit seiner Mediennutzung. Manchmal fällt es Jugendlichen schwer, sich selbst einzuschränken und sie wünschen sich Unterstützung dabei. Hier können Sie sich einbringen - genauso wie bei der Überlegung, welche anderen Freizeitaktivitäten in Frage kommen als Alternativen zum Gamen bzw. zur Social Media-Nutzung.
Wichtig ist auch, zu verstehen: Es ist nicht das Internet an sich, das süchtig macht. Aber es gibt Inhalte, die so ausgestaltet sind, dass sie Suchtpotenzial haben. Dazu gehören Games oder soziale Netzwerke wie TikTok, Snapchat und Instagram. Die Anbieter wollen, dass die Nutzenden möglichst lange online bleiben. Deswegen wenden sie Strategien an, um das zu erreichen, zum Beispiel Empfehlungen, die unseren individuellen Vorlieben entsprechen, oder Belohnungen für Spielfortschritte und tägliches Interagieren.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über solche Mechanismen und versuchen Sie zu verstehen, was hinter dem intensiven Medienkonsum steht. Manchmal ist es der Wunsch nach Zugehörigkeit oder die Erfahrung, Anerkennung zu finden und Erfolge zu erleben.
Professionelle Hilfe finden Sie bei Suchtberatungsstellen.
Games
Soziale Netzwerke
Weiterführende Links
Beratungsstellen
Das Wort Sexting steht für das digitale Verschicken von erotischen Bildern oder Videos, auf denen eine Person nackt oder in einer aufreizenden Pose zu sehen ist. Für Jugendliche kann es eine Form der Kommunikation darstellen – sei es innerhalb einer Beziehung, beim Flirten oder im Ausprobieren der eigenen (sexuellen) Identität. Wichtig ist für Jugendliche zu wissen, welche Risiken damit verbunden sind und wann sich auch Minderjährige strafbar machen können.
Sexting ist nicht strafbar, sofern es einvernehmlich stattfindet und der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt. Aber ein als Liebesbeweis geschicktes Nacktfoto kann nach einer Trennung zur Gefahr werden: Es kann aus Rache an andere verschickt oder sogar online öffentlich publiziert werden.
Strafbar ist Sexting, wenn Druck aufgesetzt wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand schreibt: «Schick mir ein Nacktfoto, sonst ist es aus zwischen uns.» Oder: «Du liebst mich doch, oder? Beweis es mir und schick ein Foto in sexy Unterwäsche.» Auch Erpressungen mit intimen Aufnahmen kommen immer wieder vor. Dann spricht man von Sextortion.
Ihr Kind sollte sich bewusst sein, dass jedes Foto an eine breitere Öffentlichkeit geraten kann, als einem lieb ist. Und sprechen Sie auch darüber, dass man sich nicht nackt zeigen muss, um erotisch oder sexy auszusehen.
Wer dennoch in einem sicheren Setting Nacktfotos machen möchte, sollte darauf achten, dass das Gesicht nicht zu sehen ist und auch sonst nichts auf die eigene Person hinweist.
Pornografie und Sexting
Sexuelle Übergriffe
Weiterführende Links
Seiten für Jugendliche
Das Thema Sexualität übt auf Heranwachsende einen grossen Reiz aus. Es gibt Kinder und Jugendliche, die aus dem Netz heruntergeladene Pornoclips oder -bilder übers Handy untereinander austauschen. Wichtig ist hier, sich die rechtliche Lage bewusst zu machen. In aller Kürze: Kinder unter 16 Jahren machen sich nicht strafbar, wenn sie sich online Pornoclips anschauen. Aber wer (egal wie alt) unter 16-Jährigen pornografisches Material zum Beispiel per WhatsApp schickt oder auf dem Handy zeigt, macht sich strafbar.
Wenn Sie also auf dem Handy Ihres Kindes Pornos finden, müssen Sie aktiv werden. Ihr Kind muss wissen, dass es die Videos und Bilder nicht weiterschicken darf. Vorsicht: gewisse Messenger-Dienste speichern alle zugeschickten Videos oder Fotos automatisch auf dem Smartphone ab. Dies sollte deaktiviert werden, wenn das Kind beispielsweise in grossen Messenger-Gruppen Mitglied ist.
Jugendschutzprogramme filtern pornografische Inhalte heraus, können jedoch keinen kompletten Schutz bieten.
Auch wenn es vielleicht kein einfaches Thema ist: Offene Gespräche über Pornografie, Sexualität und Rollenbilder helfen, Bilder kritisch zu hinterfragen und einzuordnen. Denn Medien wirken dort am stärksten, wo keine eigenen Erfahrungen, keine Auseinandersetzung mit anderen und keine klare, eigene Haltung vorliegen.
Pornografie und Sexting
Influencerinnen sind die Stars der jungen Internetgeneration. Sie sind Idole und gleichzeitig Vorbilder für viele Heranwachsende. Oft sind sie nicht viel älter als ihre Fans und posten nicht nur zu ihrem privaten Leben, sondern zu Themen, die Kinder und Jugendliche begeistern: Lifestyle, Mode & Beauty, Fitness, Gesundheit, Gaming oder Comedy, aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz, mentale Gesundheit oder soziale Gerechtigkeit.
Mit ihren Beiträgen auf Instagram, YouTube, Snapchat oder TikTok erreichen einige Internetpersönlichkeiten Klickzahlen bis in Millionenhöhe und verdienen unter Umständen viel Geld.
Dieses vermeintlich glamouröse und faszinierende Leben kann auf Jugendliche anziehend wirken. Sie bekommen den Eindruck, dass es ein einfacher Weg zu Ruhm und Erfolg sei. Die Herausforderungen und Anstrengungen hinter den Kulissen werden meist nicht gezeigt.
Auch wenn der Wunsch vielleicht irritiert: Nehmen Sie das Interesse ernst und gehen Sie offen ins Gespräch. Ganz so, wie Sie das bei anderen Berufswünschen auch machen würden. Es ist wichtig, mit Jugendlichen über die Realitäten und Hürden dieses Berufsfelds zu sprechen, um ein ausgewogenes Verständnis zu vermitteln.
Werbung und Influencing
Weiterführende Links
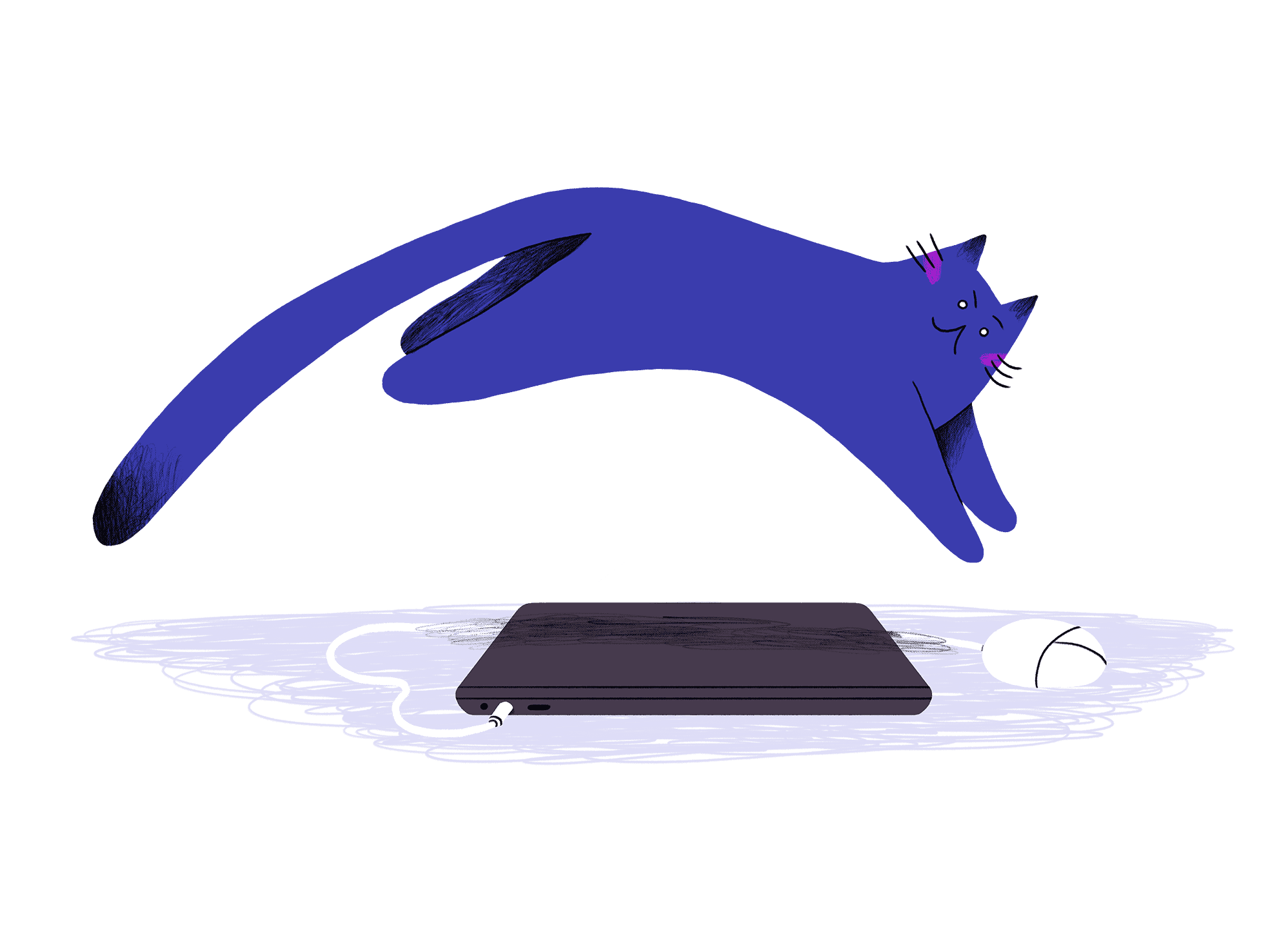
Inhalte von Games, Filmen und Serien können auch Jugendliche verunsichern, ängstigen oder emotional überfordern. Es ist darum wichtig, dass sie das Prinzip der Altersfreigaben verstehen – und dass es nicht unbedingt cool ist, einen Film zu schauen oder ein Game zu spielen, die für das eigene Alter nicht freigegeben sind.
Problematisch sind zum Beispiel:
Realistisch dargestellte Gewalt, z. B. Folter oder Suizidversuche
Sexualisierte oder erniedrigende Darstellungen ohne Einordnung
Angst auslösende Szenen, etwa bei Horrorfilmen mit psychologischen Elementen
Themen wie Selbstverletzung, Missbrauch oder Tod, wenn sie drastisch oder ohne Kontext gezeigt werden
Verharmlostes Risikoverhalten, z. B. Drogenkonsum oder gefährliche Mutproben
Neben Altersfreigaben veranschaulichen bei Videospielen die europaweit einheitlichen PEGI-Symbole, ob in dem Spiel Gewalt, Sex, Drogen, Diskriminierung, vulgäre Ausdrücke, beängstigende Inhalte oder Glücksspielelemente vorkommen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und seien Sie da, um bei Verunsicherung gemeinsam zu entscheiden oder zu spielen.
Letzte Aktualisierung des Textes am 12.11.25